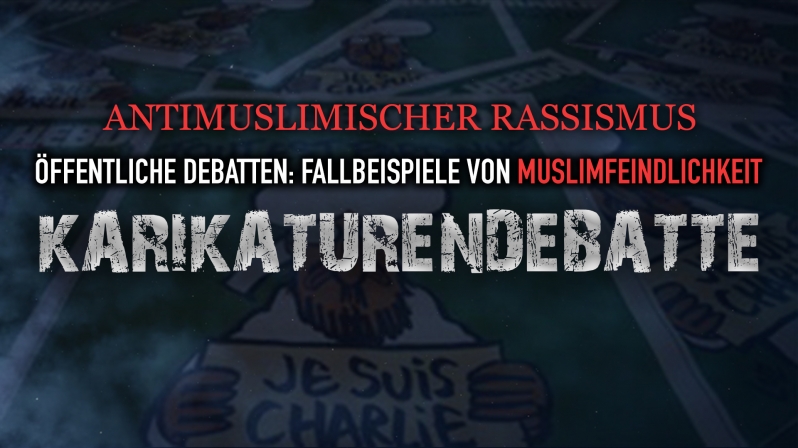
Antimuslimischer Rassismus
07-09-2024
Karikaturendebatte
In den vergangenen Jahrzehnten kam es immer wieder zu hitzigen Kontroversen um die Darstellung ‚des Islams‘ im Kontext von Satire und politischen Karikaturen. Zu den aus deutscher Perspektive bekanntesten Fällen gehören neben Salman Rushdies Roman „Die satanischen Verse“ insbesondere die „Mohammed-Karikaturen“ der dänischen Tageszeitung Jyllands-Posten sowie die satirischen Zeichnungen des französischen Magazins Charlie Hebdo. Unterzieht man die Medienberichterstattung über jene Karikaturendebatten einer genaueren Analyse, so lassen sich wiederkehrende Topoi finden, die sich – teils explizit, teils latent – antimuslimischer Symboliken bedienen. Als Bestandteile z. T. jahrelang geführter öffentlicher Debatten prägen sie das gesellschaftliche Bild des Islams auf besondere Weise. Wie lassen sich diese Debatten mit Blick auf das Phänomen Muslimfeindlichkeit bewerten? Welche Positionen waren in ihnen vorherrschend und inwiefern gingen diese mit tradierten orientalistischen Vorstellungen über ‚den Islam‘ und ‚den Westen‘ einher?
Zu einem der ersten Schlüsselereignisse der deutschen Islamberichterstattung zählt die Fatwa gegen den indisch-britischen Autor Salman Rushdie durch den iranischen Staatsführer Ayatollah Chomeini im Jahr 1989. Rushdie hatte ein Jahr zuvor seinen Roman „Die satanischen Verse“ veröffentlicht, der das Leben des Propheten Mohammed fiktional porträtiert und dabei mit satirischen Überzeichnungen arbeitet. Das Buch sorgte weltweit für Entrüstung und löste Demonstrationen aus, die – überwiegend von islamistischen Fundamentalist*innen initiiert – auch gewaltvolle Formen annahmen. Die Medienaufmerksamkeit rund um die Buchveröffentlichung und die sie betreffenden Proteste war extensiv, wobei im liberal-konservativen Pressespektrum die Vorstellung von einer Kulturdifferenz zwischen Islam und Westen zum Konsens wurde (vgl. K. Hafez 2002b: 263). Dies ging so weit, dass das Fortbestehen der multikulturellen Gesellschaft, in der Muslim*innen friedlich neben anderen Bevölkerungsgruppen koexistierten, grundsätzlich bezweifelt und der Ruf nach kultureller Assimilation laut wurde (vgl. ebd.).
Jener Unvereinbarkeitstopos wird auch in jüngeren Debatten über die Angemessenheit islambezogener Karikaturen immer wieder neu aufgelegt, so etwa anlässlich der 2006 veröffentlichten „Mohammed-Karikaturen“ der dänischen Zeitung Jyllands-Posten, die wochenlange Medienberichte, nicht zuletzt durch die gewaltvollen Ausschreitungen islamistischer Gruppierungen befeuert (vgl. Meyer 2006: 14), nach sich zogen. Dabei titelte DER SPIEGEL „Der heilige Hass. Zwölf Mohammed-Karikaturen erschüttern die Welt“ (6/2006) und legte mit der Verwendung diverser Schlüsselcodes für den Islam – arabische Schriftzeichen, die Farbe Grün, der Koran, eine verschleierte Frau – dessen Kongruenz mit dschihadistischen Gewaltaktionen und gleichzeitige Unverträglichkeit mit ‚westlichen‘ Wertestandards nahe.
Zu den medialen Kerndebatten avancierte zudem die Frage nach dem Vorrang eines von zwei rechtsstaatlichen Grundrechten, die durch die Islamkarikaturen berührt wurden: das Recht auf freie Meinungsäußerung oder das Recht auf Religionsausübung. Dabei kam auch hier eine polarisierende Darstellungslogik zum Einsatz, die beide Grundrechte gegeneinander in Stellung brachte, statt die Möglichkeiten ihrer gleichzeitigen Verwirklichung und Vereinbarkeit auszuloten. So machte sich beispielsweise der Autor des Artikels „Im Mauseloch der Angst“ (Broder 2010) für eine uneingeschränkte Anwendung der Meinungsfreiheit stark, während er Aufrufe zur Deeskalation und Rücksichtnahme offen verhöhnte und Muslim*innen pauschal als unwissende, ehrversessene, blutrünstige Horden dämonisierte.
Dabei gibt es aus juristischer Sicht zwischen Meinungs- und Religionsfreiheit gar keinen fundamentalen Widerspruch, wie der UN-Sonderberichterstatter Bielefeldt in seinem Bericht 2016 klarstellte: „Die Religionsfreiheit schützt nicht die Religion als solche, sondern die Freiheit des Einzelnen, sich einer Religion anzuschließen oder auch auf Religion zu verzichten.“ Die Religionsfreiheit schließe dabei eine kritische oder auch satirische Auseinandersetzung mit der Religion nicht aus. „Die Einschätzung, nach der die Meinungsfreiheit und die Religionsfreiheit in einem unauflösbaren Spannungsverhältnis zueinander stehen, beruht auf einem Missverständnis.“ (Bielefeldt 2016) Über dieses Missverständnis wurde in der deutschen Presseberichterstattung jedoch nicht aufgeklärt, wie Naab und Scherer in ihrer Analyse des Mohammed-Karikaturenstreits von 2006 zeigen. Vielmehr standen v. a. Begrenzungen und Bedrohungen der Meinungsfreiheit im Fokus – ohne dabei über die zentrale Bedeutung dieses Grundrechts für das politische System als Ganzes zu reflektieren (vgl. 2009: 387).
Verschiedene Studien belegen eine wiederkehrende Dichotomisierung ‚des Islams‘ gegenüber ‚dem Westen‘ bzw. der Demokratie als vermeintlich ausschließlich ‚westlich-abendländische‘ Errungenschaft im Kontext der Karikaturendebatten (vgl. u. a. Sinram 2013; Naab/Scherer 2009; Görlach 2009; K. Hafez 2002b). Auch die Berichterstattung über die Anschläge auf die Redaktion des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo 2015 und die Tötung des französischen Lehrers Samuel Paty bilden hierzu keine Ausnahme. Auf Ereignisebene gehören sie in eine Reihe dschihadistisch motivierter Versuche, eine buchstabentreue, ahistorische Lesart des Korans und der Scharia gegenüber dem Menschenrecht auf freie Rede gewaltvoll durchzusetzen. Mit Blick auf die Berichterstattung lässt sich auch hier der Topos des Islams als gewaltbereiter und archaischer Religion wiederfinden. So titelte der FOCUS „Das hat nichts mit dem Islam zu tun – Doch! Warum Muslime ihre Religion jetzt erneuern müssen – und wie die Freiheit zu verteidigen ist“ (4/2015) und disqualifiziert damit auf pauschale Weise Differenzierungsversuche, die auf politische bzw. ideologische Motive dschihadistischer Ableger verweisen, statt den Islam als Ganzes zu beschuldigen. Bildlich unterstrichen wird dies durch die Abbildung eines Kalaschnikow-Maschinengewehrs im Profil. Dass eine derartige Verkürzung komplexer Ursachenzusammenhänge zwar journalistisch unzureichend, wirtschaftlich jedoch äußerst rentabel ist, zeigt die erhebliche Absatzsteigerung, die diese Ausgabe dem Magazin bescherte (vgl. Hein 2015).
Auffällig an der Karikaturen-Berichterstattung ist zudem, dass die Kritik am Inhalt der Hebdo-Zeichnungen allenfalls am Rande aufschien. Diese zeigen hakennasige Araber, von Kugeln durchlöcherte Korane und die Verspottung von Opfern eines Massakers. Nach dem Attentat zeigte die erste Ausgabe des Magazins eine Karikatur schwangerer Frauen in Abayas, die sich die Bäuche halten, mit dem Kommentar: „Boko-Haram-Sexsklavinnen in Aufruhr: ‚Fasst unser Kindergeld nicht an!‘“ Hier wird unter anderem auf das gängige Stereotyp von Musliminnen als „Gebärmaschinen“ (in der Neuen Rechten „Geburtendschihad“) rekurriert.41 Eine rassismuskritische Bewertung und Einordnung der Karikaturen fand in weiten Teilen der deutschen Medienlandschaft dabei nicht statt.
Bestandteil einer solchen (selbst-)kritischen Analyse wäre auch die Erwähnung von und konstruktive Auseinandersetzung mit Formen von institutionellem und alltäglichem Rassismus, wie er in verschiedenen Gesellschaftsbereichen auftritt und für eine Ungleichverteilung von Chancen zwischen Muslim*innen und Nicht-Muslim*innen sorgt. Es ist eben dieser soziale und politische Kontext, in den hinein islambezogene Karikaturen publiziert und in dem deren Nachwirkungen problematisiert werden.
In ihrer ursprünglichen Idee schießt Satire nach oben, ihre erklärten Feinde sind die Mächtigen, die Obrigkeiten, die Elite im Staat und in machtvollen Institutionen der Gesellschaft. Aufgabe politischer Karikaturen ist es, „Absurditäten, Machtmissbrauch, Fehlentwicklungen, Spannungsfelder und Widersprüche im gesellschaftlichen und politischen Leben [zu] kommentieren“ (Knieper 2001: 266). Zwar war in den öffentlichen Debatten Tucholskys berühmtes Bonmot „Satire darf alles“ ein ständiges Schlagwort. Übersehen wurde dabei jedoch häufig, dass schon dieser einschränkte: Eine Satire, die „zur Zeichnung an einer Kriegsanleihe auffordert, ist keine“ (Tucholsky 1975: 42; s. a. Schuhler 2015: 28). Man könnte Tucholsky hier frei übersetzen: Eine Satire, die bestehende gesellschaftliche Schieflagen vertieft, statt sie offenzulegen, um sie perspektivisch zu überwinden, löst ihr demokratisches Potenzial nicht ein.
Eine rassismuskritische Bewertung und Einordnung der Karikaturen ist für ein friedvolles Miteinander und eine funktionierende demokratische Streitkultur essenziell. Auch bedarf es einer fundierteren medialen Auseinandersetzung mit dem Grundrecht der Meinungsfreiheit an sich. Dies wäre wichtig, um innerhalb der Zivilgesellschaft Gegenpositionen aushalten und Kontroversen friedlich austragen zu können – auch wenn man sie inhaltlich nicht teilt.
Muslimfeindlichkeit – Eine deutsche Bilanz
Bundesministerin des Innern und für Heimat
| Heute | 2663 |
| Insgesamt | 5214748 |
| Am meisten | 42997 |
| Durchschnitt | 1846 |